„Viele in den USA haben fast keine Wahl“ – USA-Experte Mike Cowburn über ein polarisierendes Wahlsystem
Dr. Mike Cowburn arbeitet als Postdoc am Lehrstuhl für Digitale Demokratie der European New School (ENS) of Digital Studies. In diesen Tagen erscheint sein Buch über das amerikanische Wahlsystem. Für seine Doktorarbeit hat er sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Vorwahlen das Parteiensystem beeinflussen. Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl spricht er im Interview über die Einzigartigkeit des amerikanischen Wahlsystems und darüber, welche Entwicklungen auch auf Europa zukommen könnten.
Herr Cowburn, Ihr Buch erscheint in einer Zeit, in der man gar nicht umhinkommt, mit Spannung auf den Präsidentschaftswahlkampf in den USA zu schauen. Wie beobachten Sie das als Insider, der sich intensiv mit dem politischen System in den USA beschäftigt hat?
Ich war vor Kurzem in den USA bei einer großen Konferenz mit vielen Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern und das vorherrschende Gefühl war: Wir müssen diese Wahl einfach nur hinter uns bringen. Viele meiner Freunde in den USA, zum Beispiel in Washington oder Oregon, haben außerdem fast keine Wahl. Es liegt am Wahlsystem, das tatsächlich nur in sechs oder sieben Staaten entschieden wird: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und vielleicht North Carolina. Das war bei meinem letzten Besuch wirklich interessant. Ich war eine Woche in Oregon und eine Woche in Philadelphia. In Oregon sieht man nichts. Es gibt keine Plakate, gar nichts; ein einziges Trump-Plakat habe ich während einer sechsstündigen Fahrt auf dem Highway gesehen. In Philadelphia war es das ganze Gegenteil. Und dieses Phänomen ist allein im Wahlsystem begründet; das ist es, was mich interessiert.
Foto Mike Cowburn und Buchcover
In Europa schaut man mitunter ungläubig darauf, dass es gar nicht so unwahrscheinlich für Donald Trump ist, erneut zum Präsidenten gewählt zu werden. Ist das ein überheblicher Blick?
Teilweise. Fakt ist, dass es viele verschiedene Gruppen in den USA gibt, die wahrnehmen, dass ihnen Trump etwas geben kann, zum Beispiel evangelische Menschen, die Trump vielleicht nicht mögen, die aber sehen, dass er drei neue Richter in den Obersten Gerichtshof bringen kann, die ihnen gefallen. Auch der Steuer-Plan bringt für einige Vorteile. Es sind also teilweise sehr rationale Entscheidungen, auch wenn man denkt, man kann Trump vielleicht nur irrational wählen.
Gerade erscheint Ihr Buch „Party Transformation in Congressional Primaries“, das auf Ihrer Doktorarbeit von 2022 basiert. In der Ankündigung heißt es, dass das Buch mit einigen grundlegenden Annahmen über amerikanische Wahlen aufräumt. Was steckt dahinter?
Mein erster Hauptpunkt ist, dass sich die Vorwahlen für den Kongress verändert haben. Früher, vor 20 Jahren, ging es dabei um lokale oder regionale Kompetenz. Das hat sich grundlegend geändert. Bei dem zweiten Punkt geht es um die Frage, ob die Vorwahlen für eine Polarisierung im Kongress sorgen – davon ging man bisher immer aus. Es gibt die Idee, dass die Demokrat*innen linker und die Republikaner*innen rechter werden, weil das die Wählerinnen und Wähler in den Vorwahlen so wollen. Aber die Daten geben das nicht her. Ich komme in meinem Buch zu dem Schluss, dass es eben kein Bottom-up-Phänomen ist. Die Polarisierung kommt nicht von den Wählerinnen und Wählern, sondern von anderen Gruppen innerhalb der Parteien. Konkurrieren zwei oder mehr Kandidatinnen und Kandidaten von einer Partei, sind die mit klaren Positionen berühmter, bekommen mehr Geld, können mehr werben und werden so den Wählerinnen und Wählern bekannter. Es liegt also nicht an einer ideologischen Nähe zwischen Wähler*innen und Kandidat*innen sondern daran, dass die extremen Kandidat*innen Vorteile haben.
Sie haben gesagt, die Entwicklung ist in den vergangenen 20 Jahren zu beobachten? Was sind die Ursachen?
Ich habe eine Datengrundlage von 2006 bis 2020, also 14 Jahre. Was ich da 2006 sehe ist, dass es bei den Vorwahlen damals einzig um regionale Kompetenz und Erfahrung der Kandidatinnen und Kandidaten ging, also im Kern um die Aussagen: Ich weiß, was die Menschen in unserem Bezirk brauchen. Ich kann Geld aus Washington in meine Region bringen. Auch die Medien hatten nicht so viel Interesse an den Vorwahlen. Das wandelt sich total. Mit der Tea Party ab 2010 und ein bisschen später in der demokratischen Partei geht es auf einmal um nationale Themen, es geht um Abtreibung, um Waffenrechte, um Themen, die nicht spezifisch sind für die Region. Überregionale Gruppen unterstützen die Kandidat*innen dann mit mehr Geld und die mediale Aufmerksamkeit wächst. Das ändert die mediale Perspektive auf nationaler und sogar internationaler Ebene.
Welche Rollen spielen Social-Media-Plattformen in dieser Entwicklung?
Vor 20 Jahren musste man viele Leute in seiner Partei kennen, um sich als Kandidat*in durchzusetzen. Jetzt kann man auch zu Hause sitzen und die Menschen über X oder andere Kanäle erreichen. Das ändert die Logik und die Logistik einer Kampagne. Diese vertikale Kommunikation zwischen den Kandidat*innen und den Wähler*innen zeigt sich auch an den besonders charismatischen Politikerinnen und Politikern – ich nenne hier mal Trump und Wagenknecht – die wirken über ihre mediale Präsenz und müssen gar nicht erst durch die Partei-Strukturen gehen.
Hinzu kommt die horizontale Kommunikation, die keine nationalen Grenzen hat. Es gibt hier einen Einfluss von den Parteien untereinander, linke Parteien in den USA, England und Deutschland reden miteinander, genauso wie auf der rechten Seite. Wenn jetzt die republikanische Partei beispielsweise Viktor Orban über Social Media unterstützt, dann hat das eine ganz andere Wirkung als vor 20 Jahren, als man vielleicht einen Unterstützungsbrief geschrieben hat.
Haben Ihre Erkenntnisse auch eine Aussagekraft für andere Wahlen, beispielsweise in Europa oder Deutschland? Auch hier ging es in den jüngsten Landtagswahlen ja um internationale Politik.
Es gibt viel Forschung in diese Richtung. Darin wird gezeigt, es ist nicht nur ein USA-Phänomen, es passiert auch in Europa. Allerdings sind die Gründe für diese Entwicklung in den USA noch stärker, beispielsweise die Nationalisierung der Medien: In den USA sind viele regionale Zeitungen und TV-Kanäle geschlossen. Die Leute konsumieren nur überregionale Medien und verstehen nicht mehr, was in Kansas oder Nebraska passiert. Das ist in Deutschland noch anders; es gibt noch unterschiedliche regionale Medien. Aus meiner Sicht gibt es die Entwicklungen auch in Europa, aber sie passieren langsamer. Diese Frage, inwieweit die von mir festgestellten Phänomene in den USA auch in Europa wichtiger werden, wird wohl mein nächstes Projekt.
Am 26. November 2024, 18.00 Uhr, präsentiert Mike Cowburn sein Buch „Party Transformation in Congressional Primaries“ im John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien (JFKI) der Freien Universität, Lansstraße 7–9 in 14195 Berlin, Raum 340.
Zur Person
Mike Cowburn interessiert sich schon seit seinen Studienzeiten im britischen Exeter für das amerikanische Wahlsystem und den US-Kongress. Für seinen Master in Nordamerikastudien kommt er an die Freie Universität Berlin, wo er auch seine Doktorarbeit abschließt. Seit 2023 arbeitet er als Wissenschaftler an der European New School of Digital Studies und forscht an der Seite von Prof. Dr. Ulrike Klinger zu politischer Kommunikation.
Frauke Adesiyan
Zurück zum Newsportal

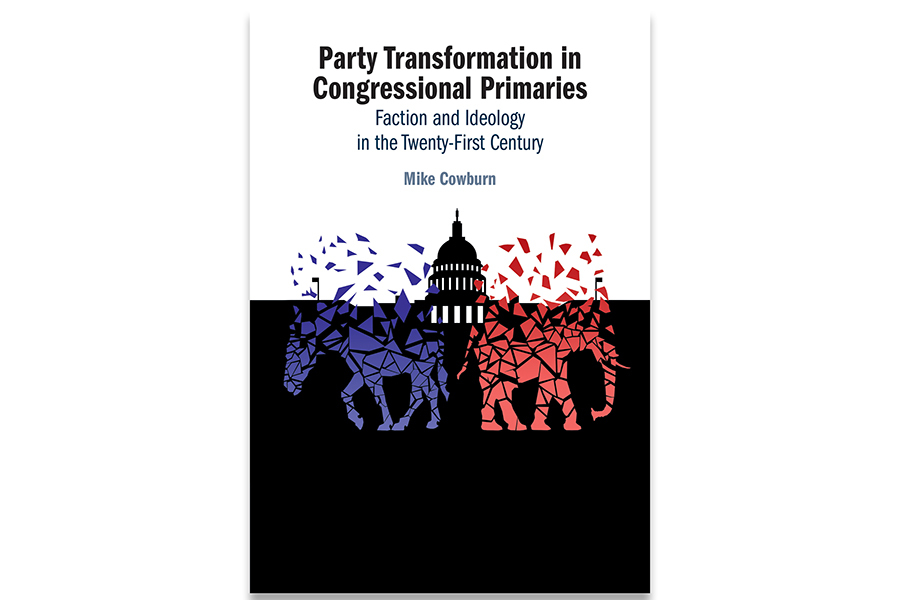
Beitrag teilen: